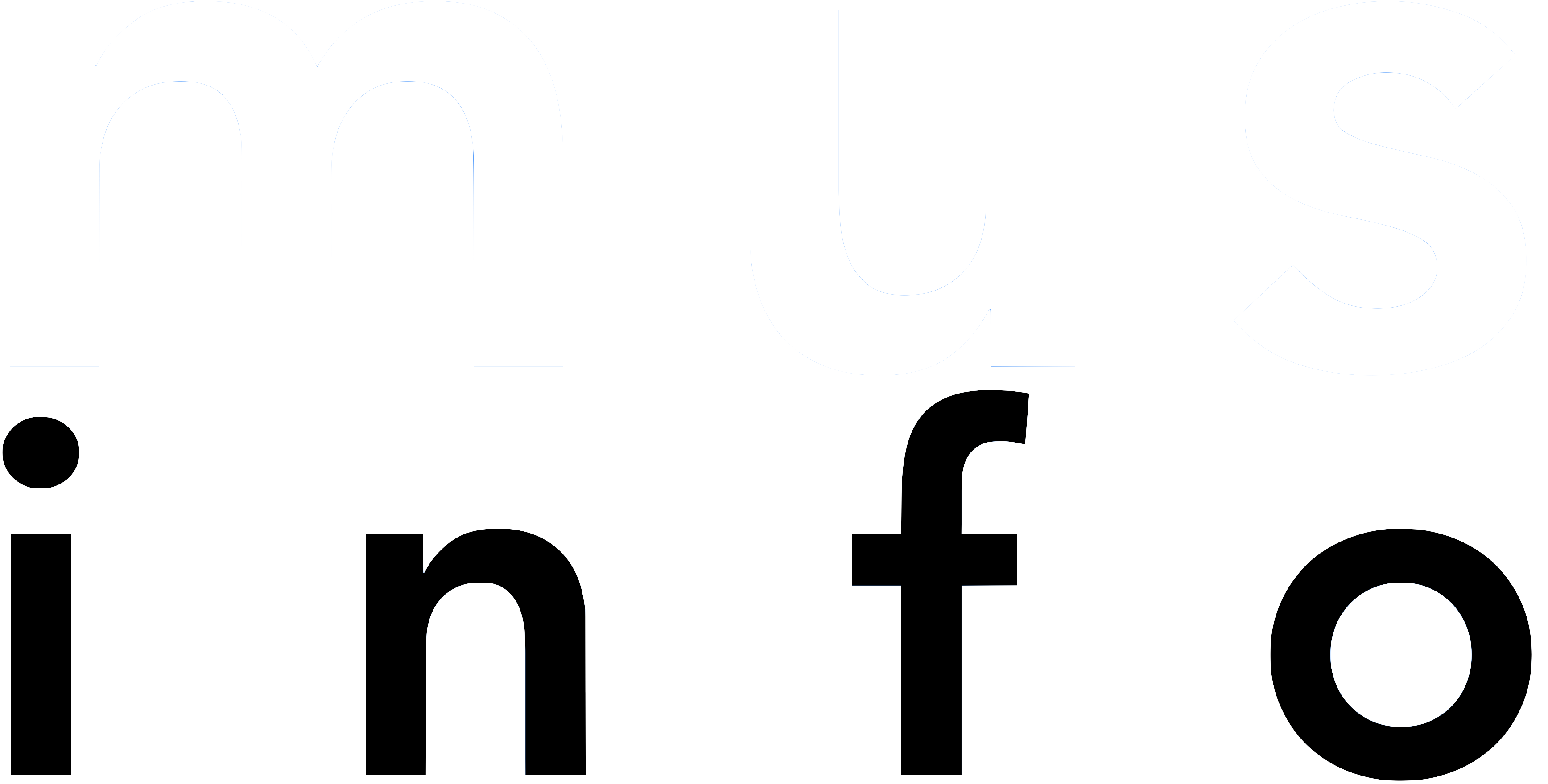Wie entstehen wissenschaftliche Disziplinen?
Ein ambulanter Schriftwechsel
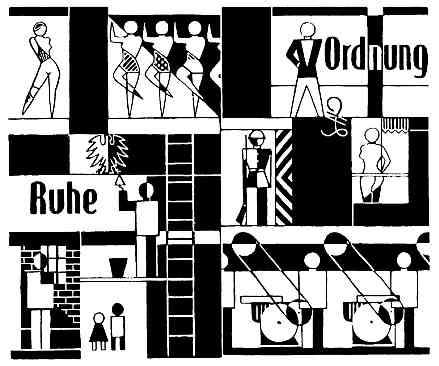
Barbara Orland: Hast Du Dich jemals gefragt, Johannes, wie viele anerkannte wissenschaftliche Disziplinen es heute wohl geben mag? Dank Wikipedia komme ich auf eine (allerdings unvollständige) Zahl von circa 380, darunter einige mir bis dato unbekannte Fächer wie die Trassologie (Spurensicherung innerhalb der Kriminalistik), Gemmologie (Edelsteinkunde), Dendochronologie (Altersbestimmung anhand von Baumringen) oder die Zezidiologie (ein Teilgebiet der Botanik, das sich mit Pflanzengallen beschäftigt). Die meisten Wissenszweige werden als Subdisziplinen eines grösseren Astes des wissenschaftlichen Stammbaumes geführt. Andere sind als interdisziplinäre Wissensgebiete ausgewiesen. Die dicksten Arme wie Medizin, Physik, Philosophie erwähnt die Liste erst gar nicht. Offensichtlich sind diese Fächernamen heutzutage zu unspezifisch und bedürfen der weiteren Differenzierung. Andere wiederum, die ich selbstverständlich in einer Liste der anerkannten Wissenschaften erwartet hätte, tauchen nicht auf, so z.B. die Mathematik, Geschichte, Linguistik, der Maschinenbau oder die Informatik.
Was eine wissenschaftliche Disziplin ist, scheint danach hochgradig arbiträr zu sein – jedenfalls in Wikipedia, der angeblich grössten Enzyklopädie aller Zeiten. Wissensgebiete wandeln sich, keine Frage. Doch wer bestimmt eigentlich, was eine «anerkannte» wissenschaftliche Disziplin ist? Lassen wir mal die Frage aus dem Spiel, wie die Wiki-Listen zustande kommen, so bleibt das Problem: Ab wann ist es überhaupt gerechtfertigt, von einer Wissenschaftsdisziplin zu sprechen? Gibt es hierzu plan- und kontrollierbare Entscheidungsprozesse? Wo Grenzgefechte ausgetragen, Prioritätsansprüche geklärt und Claims abgesteckt werden? Ist eine Wissenschaft begründet, wenn sie über akademische Institutionen, Fachzeitschriften, Ausbildungsgänge verfügt und Arbeitsverhältnisse begründet?
In historischer Perspektive lassen sich derartige Prozesse auf den ersten Blick recht gut nachvollziehen. Mal war es ein neues Forschungsobjekt (zum Beispiel die Elektrizität), mal eine neue Forschungsmethode (etwa die Röntgenstrahlen) oder eine überragende Forscherpersönlichkeit (zum Beispiel Louis Pasteur), die den Anstoss gegeben haben. Fragt man dann aber, warum die Elektrizität nicht schon früher wissenschaftliche Aufmerksamkeit auf sich gezogen hat, die Röntgenstrahlen erst so spät entdeckt wurden, ein Louis Pasteur seine Vorläufer hatte, dann zerfliessen die Ursprungsszenarien sehr schnell wieder. Je weiter wir den Kontext der Betrachtung wählen, umso überraschender wirken dann viele Entwicklungen. Wie also kommen neue Disziplinen in die Welt und verschwinden alte?
Johannes Fehr: Nein, Barbara, wieviele Disziplinen (ob wissenschaftlich anerkannte oder als wissenschaftlich anerkannte) es nun genau oder auch nur ungefähr geben soll, habe ich mich nie wirklich gefragt. Und, ehrlich gesagt, macht mich die Zahl recht ratlos. Sind das nun viele oder letztlich doch eher wenige? Gemessen woran? Im Zusammenhang mit dem vereitelten Attentatsversuch von Detroit vom 25. Dezember 2009 war davon die Rede, dass es in den USA mittlerweile 27 Geheimdienste gebe. Die Zahl sagt mir schon eher etwas. Jedenfalls kann ich mir vorstellen, dass es bei einer solchen Zahl ziemlich schwierig sein dürfte, die von den einzelnen Diensten zusammengetragenen Daten zu verknüpfen.
Dass, wie Du schreibst, es hochgradig arbiträr zu sein scheint, was als Disziplin gezählt wird und was nicht, ist allerdings auch mein Eindruck. Denn die Liste, auf die ich in Wikipedia gestossen bin, mit der Eingabe «Disziplin» respektive «Einzelwissenschaft», ist um einiges kürzer, enthält aber all die Disziplinen wie Medizin, Physik, Philosophie, Mathematik, Linguistik etc., die Du vermisst hast. Auf der entsprechenden englischsprachigen Wikipedia-Seite ist dann die Liste viel länger und dürfte sich der von Dir genannten Zahl schon eher nähern.
Es würde mich wundern, fände sich in den bereits genannten Listen nicht auch eine Disziplin, die den Umgang mit Wikipedia oder mit anderen Enzyklopädien zum Gegenstand hat. Und zweifellos wird es auch einige historische und vergleichende Studien geben, in denen der Wandel der Suchstrategien im Zusammenhang mit medientechnischen Umbrüchen und Entwicklungen untersucht wird. Doch das ist ja nicht das Thema, mit dem wir uns hier befassen wollen, ebenso wenig wie die Zahl wissenschaftlicher Disziplinen. Worum es hier gehen soll, ist vielmehr die Frage, wie (anerkannte, wissenschaftliche) Disziplinen entstehen. Wobei – und insofern leuchtet es mir ein, dass Du mit der Frage nach der Zahl eingestiegen bist – zu den Disziplinen und ihrem Entstehen gehört, dass es mehrere gibt.
Disziplinen und ihr Entstehen, so würde ich jetzt jedenfalls einmal behaupten, haben mit der Einsicht zu tun, dass es nicht einen einheitlichen, allumfassenden Wissensschatz gibt und auch keine Universalwissenschaft, die auf alles und jedes die passende Antwort bereithält. Disziplinen haben etwas damit zu tun, dass (irgendwie) brauchbares Wissen über ein Phänomen oder einen Vorgang nur zustande kommt, indem man einen bestimmten Gesichtspunkt einnimmt und sich auf eine bestimmte Weise mit einem Problem befasst. Womit keineswegs gesagt sein soll, dass dies bereits eine hinreichende Bedingung für das Entstehen einer Disziplin wäre. Du hast ja bereits einige der gesellschaftlichen Konstituenten (wie Fachzeitschriften, Ausbildungsgänge, Arbeitverhältnisse etc.) genannt, die offensichtlich nötig sind, damit man von einer anerkannten wissenschaftlichen Disziplin sprechen kann. Eine Disziplin, das will ich damit nur sagen, kann nie Angelegenheit einer Einzelperson oder lediglich einer Gruppe sein.
Wenn es nun, so betrachtet, sinnvoller ist, nach dem Entstehen von Disziplinen zu fragen, statt nach dem Entstehen einer Disziplin oder sogar der Disziplin, scheint mir die Frage «Wie entstehen Disziplinen?» in anderer Hinsicht nicht unproblematisch. Denn sie impliziert, dass es so etwas wie Regelmässigkeiten oder Gesetze gibt, die für alle Disziplinen gleichermassen gelten, und dass es darum geht, diese zu beschreiben oder herauszuarbeiten. Dass man Gemeinsamkeiten für alle Disziplinen finden kann, will ich gar nicht bestreiten, wir haben ja schon einige genannt. Eine weitere wäre vielleicht: Disziplinen entstehen nicht von heute auf morgen. Doch neben solchen Gemeinsamkeiten oder Gemeinplätzen, zu denen man kommt, wenn man dieser Frage nachgeht, wird, so scheint mir, dasjenige ausgeblendet, was die Disziplinen und ihre Entstehung unterscheidet. Ohne dass ich das hier gleich belegen kann, würde ich behaupten, dass die Entstehung neuer Disziplinen im 19. Jahrhundert ziemlich anders ausgesehen haben dürfte als heute. Und wie es Unterschiede in Abhängigkeit von der Zeit gibt, wird es solche auch in Bezug auf den Ort geben. Oder im Zusammenhang mit politischen Rahmenbedingungen. Wie soll aber all dem Rechnung zu tragen in der Lage sein, wer nicht Experte in historischer und systematischer Disziplinologie ist? Das bin ich nun wirklich nicht, und habe auch nicht im Sinn, es noch zu werden. Hingegen interessiert mich was anderes, und darüber würde ich mich gerne mit Dir unterhalten. Nämlich: Was ist es wohl, was man wissen will, wenn man danach fragt, wie Disziplinen entstehen? Worin besteht der Reiz dieser Frage? Was macht sie interessant? Mich erinnert sie an eine andere, die in letzter Zeit häufig gestellt wird: Wie entsteht neues Wissen? Oder: Wie kommt Innovation zustande? Weshalb werden Fragen wie diese gestellt? Was erhofft man sich von ihrer Beantwortung? Was sagen sie über uns und unsere Zeit aus?
Barbara Orland: Gut, lieber Johannes, unterhalten wir uns nicht über die quantitative, sondern die qualitative Dimension der Frage – obwohl: einen letzten Hinweis auf die Zahlen mag ich mir nicht verkneifen. Das 20. Jahrhundert galt seit den Arbeiten des Wissenschaftssoziologen Derek de Solla Price in den 1960er Jahren als das Jahrhundert des exponentiellen Wissenschaftswachstums.1 Die These selbst hat Wissenschaft erzeugt. Seither gibt es die empirisch-quantitative Forschung der Szientometrie. Deren Aufgabe ist es, das Anwachsen der Forschung systematisch zu untersuchen. Vermutlich wirst Du hier genauere Angaben über die Anzahl der gegenwärtig existierenden Disziplinen finden. Sollte die von de Solla Price geäusserte These des exponentiellen Wachstums tatsächlich zutreffen, dann müsste die Zahl existierender Disziplinen ja unentwegt zunehmen, was offensichtlich nicht der Fall ist. Zwar wird in der Tat allerorten vom rasanten Wachstum des Wissens (nicht der Wissenschaft) geredet. Alle paar Jahre soll sich das Wissen der Menschheit verdoppeln – zudem nehme nicht nur die Menge an Wissen zu, dieses Wachstum soll auch mit einer zunehmenden Geschwindigkeit einhergehen. Ganz nach dem Motto: Je grösser ein Ding, umso schneller sein Wachstum. Im Internetzeitalter, so behaupten manche, könnten die Jungen nichts mehr von den Alten lernen.
Dennoch hält sich, wie wir gesehen haben, die Anzahl der vorhandenen Disziplinen in Grenzen. Ist das ganze Gerede vom unbegrenzten Wachstum des Wissens nur eine Legende? Ich würde meinen: Ja. Einen Beweis dafür liefert die Szientometrie. Schon de Solla Price hat bemerkt, dass sich die Wissenschaftsentwicklung nicht durch reine Veränderung der Grössenordnung auszeichnet. Der grösste Teil wissenschaftlicher Aktivität sei zeitgenössisch, habe sich in nur wenigen Jahren nach dem Zweiten Weltkrieg ausgebildet. Während zunächst ein sprunghaftes Wachstum beobachtet werden konnte, traten bald Sättigungseffekte ein. Wissenschaftsforscher haben längst nachgewiesen, dass die Wissenschaft sich im Stadium des «Steady State» mit abnehmendem Grenznutzen befindet, will sagen: Je mehr bekannt ist, desto mehr Aufwand erfordern neue Entdeckungen. Und desto schwieriger wird es, einen den Aufwand legitimierenden Nutzen aus ihnen zu ziehen. Dass es Grenzen im Wissenschaftswachstum gibt, zeigen auch die Unterschiede in den von uns verhandelten Wikipedia-Listen. Die Differenzen rühren ja nicht daher, dass Fachgebiete vergessen wurden, sondern dass nach unterschiedlichen Klassifikationsschemata vorgegangen wurde. Je nachdem, wie man schichtet, gruppiert, zuordnet, kommen andere Zahlen heraus. Numerische Informationen geben bekanntermassen interessante Details preis, wenn man nach den Messkriterien fragt.
Damit bin ich wieder bei der von Dir angemahnten Frage nach den qualitativen Veränderungen. Die Frage hat sich verschoben. Sie lautet nun nicht mehr: Wie kommen neue Disziplinen oder innovatives Wissen in die Welt? Wenn wir von Wachstumsgrenzen überzeugt sind, dann kann es nicht ständig etwas Neues geben, sondern Altes und Neues vermengen sich. Doch wie geschieht das? Wie fliessen neue Erkenntnisse in alte und umfassendere Einsichten ein? Bezogen auf Wissenschaftsdisziplinen: Wie verhalten sich die behäbigen alten Wissensformationen angesichts neuer Herausforderungen? Gehen sie auf Konfrontation, versuchen sie sich Neues einzuverleiben, oder...
Johannes Fehr: … Lass mich versuchen, Deine Fragen am Beispiel der Sprachwissenschaften aufzugreifen, deren Geschichte mir unter den akademischen Disziplinen am besten vertraut ist. Hier taucht gegen Ende des 18. Jahrhunderts eine neue Bezeichnung auf: Linguistik. Zuerst, nämlich 1777, auf Deutsch2, erste Entsprechungen auf Französisch und Englisch sind 1812 respektive 1847 zu verzeichnen. Was darunter jeweils genau verstanden wurde, ist eine Frage für sich. Einigermassen einig ist man sich hingegen, dass sich die Linguistik als wissenschaftliche Disziplin erst im Zug der Rezeption des 1916 posthum erschienenen Cours de linguistique générale von Ferdinand de Saussure etablierte. Was dieser neuen Disziplin, in Abgrenzung von bestehenden Fächern wie Philologie und Grammatik, zum Durchbruch verhalf, war die Vorstellung – oder das Versprechen –, dass sie es erlaube, Sprachen als formale Systeme zu beschreiben, deren Gesetzmässigkeiten mit naturwissenschaftlicher Strenge zu fassen seien. In der Folge wurde die Linguistik in den Rang einer Modellwissenschaft für andere sozialwissenschaftliche Disziplinen erhoben, und es kam zur Bildung einer ganzen Reihe von Subdisziplinen (wie Psycho-, Sozio- oder Ethnolinguistik).
Was an diesem Beispiel auffällt, ist sicher die lange Inkubationszeit vom Auftauchen einer neuen Bezeichnung bis zur Etablierung der wissenschaftlichen Disziplin. Man könnte aber auch sagen, dass diese Frist vergleichsweise kurz ist, gemessen an der Jahrtausende alten Tradition grammatischen Wissens, in die sich die Linguistik einschrieb. Betrachtet man diese Geschichte aus heutiger Warte, kann man feststellen, dass Linguistik als Bezeichnung einer wissenschaftlichen Disziplin zwar weiterhin existiert, dass sich aber das Selbstverständnis, Sprache als Gegenstand exakt zu fassen, weitgehend aufgelöst hat. Dass vieles von dem, was bei ihrer Gründung aus der Linguistik ausgegrenzt worden war, unter neuen Bezeichnungen – wie Textlinguistik oder linguistische Pragmatik – wieder darin Eingang gefunden hat, gehört zur Ironie der Disziplinengeschichte.
Benennungen und ihr Potential, neue Forschungsfelder und Erkenntnisgewinne in Aussicht zu stellen, scheinen mir im Auf und Ab der Disziplinen eine entscheidende Rolle zu spielen. Zurzeit lässt sich das gerade anhand der Begriffe von Inter-und Transdisziplinarität beobachten. Dem Namen nach geht es dabei um Vorgehensweisen, die darauf angelegt sind, Problemstellungen über etablierte disziplinäre Einzäunungen hinweg in den Blick zu nehmen. Schon länger ist nun aber auch hier ein Prozess der Disziplinierung und Disziplinenbildung im Gange: Institute für Transdisziplinarität werden gegründet, eigene Studiengänge werden angeboten, samt Handbüchern zur geeigneten Methode und Begrifflichkeit. Die Frage, was davon zu halten ist, beschäftigt mich umso mehr, als ich selbst nun schon länger in diesem Umfeld tätig bin. Gehört der Drang zur – neuen – Disziplin unausweichlich zum Wissenschaftsbetrieb, oder geht es nicht vielmehr darum, immer wieder die Grenzen disziplinären Zugriffs aufzuzeigen und produktiv zu unterwandern?
Barbara Orland: Ich vermute letzteres, was gegenwärtig auch am Verhältnis der Fächer Wissenschaftsforschung (Science Studies) und Wissenschaftsgeschichte (History of Science) beobachtet werden kann. Während unter dem Schirm Wissenschaftsforschung Forscher unterschiedlichster Herkunft über lange Zeit einträchtig inter-, trans- oder multidisziplinär (wie immer Du es nennen magst) zusammenmarschierten, lässt sich nun ein Abgrenzungsprozess beobachten. Erst jüngst bemerkte Lorraine Daston, Direktorin am Max-Planck-Institut für Wissenschaftsgeschichte in Berlin, dass Wissenschaftsforschung (nunmehr auf die Sozialwissenschaften bezogen) und Wissenschaftsgeschichte sich immer weniger zu sagen hätten.3 Eine «love affair» mit den üblichen Schwärmereien, Eifersüchteleien und Konkurrenz gehe ihrem Ende entgegen. Daston begründet das hauptsächlich methodisch. Die auf aktuelle Wissenschafts- und Technikentwicklungen spezialisierten Wissenschaftsforscher würden weiterhin mit sehr verschiedenen Arbeitstechniken (ethnographisch, sozial-empirisch, statistisch etc.) der Frage nachgehen, wie die Praxis der Wissenschaften aussieht, wie neues Wissen erzeugt wird und in die Gesellschaft diffundiert. In diesem Sinne sei die Wissenschaftsforschung nach wie vor buchstäblich «undiszipliniert». Die Wissenschaftsgeschichte hingegen habe sich von einem heterogenen Feld historisch arbeitender Nicht-Historiker zu einer Subdisziplin der allgemeinen Geschichtswissenschaft entwickelt. Sehr viel solider als ehedem würden heute die Arbeitsinstrumente der Historiker (Archive, handschriftliche Quellen, Bilder etc.) verwendet, um praxisbezogene Analysen von Wissenschaft durchzuführen, deren institutionelle Verfasstheit jedoch umso weniger klar ist, je weiter man in die Geschichte zurückgeht. Während die Wissenschaftsforschung selten fragen müsse, was überhaupt Wissenschaft ist (sie kann sich auf ein allgemeines Vorverständnis der existierenden Disziplinen stützen), sind die methodischen Werkzeuge und intellektuellen Gewohnheiten früherer Epochen sehr viel schwieriger dem Terminus «Wissenschaft» unterzuordnen. Historiker müssten sich zumeist grundsätzlicher mit der institutionellen Verfasstheit der Wissensproduktion auseinandersetzen, um nicht wieder in ein Narrativ zurückzufallen, das frühere Verhältnisse zu Vorgeschichten heutiger Wissenschaft macht. Ohne hier weiter ins Detail gehen zu wollen, erwähne ich Dastons Position deshalb, weil für sie nicht etwa ein gewachsener Spezialisierungsdruck Ursache für die disziplinäre Neuausrichtung der historisch arbeitenden Wissenschaftsforscher war. Das genaue Gegenteil trifft Daston zufolge zu: Die Spezialisten suchen die Nähe der Generalisten. Mit den historischen Methoden übernahmen die Wissenschaftshistoriker das Ethos der Geschichtswissenschaft – und entfernten sich von ihren sozialwissenschaftlichen Kollegen.
Man muss dieser Meinung nicht folgen, doch für unser Thema bestätigt sich erneut, dass Grenzziehungen nicht zwingend durch Innovationsdruck oder das Aufkommen völlig neuer Sachgebiete notwendig werden. Transdisziplinarität zu praktizieren, erzeugt alleine schon Druck auf die Beteiligten. Sich in Alltagsroutinen, Sprache, methodischen Präferenzen, Kompetenzen und nicht zuletzt in Weltbildern zu verständigen, kann bereits ausreichend Zündstoff für Kontroversen liefern, an deren Ende eine disziplinäre Umorientierung oder Neuausrichtung steht. Kurz: Es ist nicht von der Hand zu weisen, dass Kommunikationsprobleme verschiedenster Art zur Disziplinenbildung und -entflechtung führen.
Johannes Fehr: Ob eine Disziplin entsteht und wie sie sich entwickelt, ist demnach nicht von dem zu trennen, was sich in anderen Disziplinen abspielt. Oder anders: Was sich in einer Disziplin tut oder nicht tut, lässt sich nicht allein aus dieser heraus begreifen. Darauf wenigstens scheinen mir diese Überlegungen hinauszulaufen. Disziplinen stehen – ob sie es wollen oder nicht, ob es im disziplinären Selbstbild wahrgenommen wird oder nicht – in Wechselwirkung mit anderen Disziplinen.
Jemand, der dies gesehen hat und der daraus in den 1930er Jahren eine ebenso eigenwillige wie anregende Sichtweise der Entstehung wissenschaftlicher Tatsachen entwickelt hat, ist Ludwik Fleck, der polnische Bakteriologe und Wissenschaftstheoretiker. Fleck spricht nicht von «Disziplinen», sondern von «Denkkollektiven». Unter «Denkkollektiv» versteht er eine Gemeinschaft, die miteinander im Gedankenaustausch steht. Setzt sich dieser über einige Zeit fort, bildet sich ein für ein jeweiliges Denkkollektiv spezifischer Denkstil heraus. Ein solcher besteht in der «Bereitschaft für selektives Empfinden und für entsprechend gerichtetes Handeln», womit er laut Fleck erst die Voraussetzung dafür schafft, dass bestimmte Dinge oder Gestalten (im Sinne der Gestaltpsychologie) überhaupt wahrgenommen werden können. Entscheidend ist hier das Stichwort «selektiv». Denn ein «ausgebildeter Denkstil» ermöglicht nicht nur das Sehen bestimmter Gestalten, er schliesst zugleich «anderes Gestaltsehen» aus, weshalb Fleck auch von «Denkzwang» spricht. Aber wie soll es, wenn wissenschaftliche Disziplinen derart von einem Denkstil bestimmt sind, überhaupt dazu kommen, dass etwas Neues entdeckt wird? Wie ist es möglich, dass Denkkollektive nicht einfach in einem dogmatischen Wissenskanon erstarren? Lass mich dazu eine Passage aus dem Aufsatz Über die wissenschaftliche Beobachtung und Wahrnehmung im allgemeinen anführen, den Fleck 1935 veröffentlichte: «Man kann etwas Neues und Abgeändertes nicht einfach und sofort sehen. Zuerst muss sich der ganze Denkstil verändern, muss die ganze intellektuelle Stimmung ins Wanken kommen, muss die Gewalt der gerichteten Denkbereitschaft aufhören. Es muss eine spezifische intellektuelle Unruhe und eine Wandlung der Stimmungen des Denkkollektivs entstehen, die erst die Möglichkeit und die Notwendigkeit dazu schafft, etwas Neues, Abgeändertes zu sehen.»4
Gerade weil Fleck die Veränderung eines Denkstils somit als heftiges emotionales Geschehen schildert, stellt sich die Frage, woher der Anstoss kommen soll, der in der Lage ist, bestehende – oder festgefahrene – Wahrnehmungsmuster ins Wanken zu bringen und ein Denkkollektiv in Unruhe zu versetzen. Und genau an diesem Punkt kommt eben der Grund ins Spiel, weshalb ich Fleck überhaupt anführe. Denn was er hier zu allererst nennt, sind Impulse, die von Berührungen und Wechselwirkungen zwischen Denkkollektiven herrühren. Fleck spricht in diesem Zusammenhang auch von «Wanderungen» – zum Beispiel eines Begriffs – «von einem Denkkollektiv zum andern» und unterstreicht wiederholt die eminente «erkenntnistheoretische Bedeutung des interkollektiven Denkverkehrs». Dass zu diesem auch Missverständnisse – oder die von Dir genannten Kommunikationsprobleme – gehören, liegt auf der Hand. Diese gilt es nach Fleck aber produktiv zu machen, statt sie vermeiden zu wollen, indem man etwa nach einer die verschiedenen Disziplinen und deren Sprachen umfassenden Einheitswissenschaft sucht.
Barbara Orland: Einheitswissenschaft – damit gibst Du ein wichtiges Stichwort. Zu der Zeit, als Ludwik Fleck seine ungeheuer produktiven Überlegungen über die Entstehung wissenschaftlicher Tatsachen angestellt hat, war an anderem Ort eine Gruppe von Naturwissenschaftlern und Philosophen im «Wiener Kreis» mit exakt dieser Frage beschäftigt. Gibt es in der Vielfalt wissenschaftlicher Disziplinen nicht doch eine gemeinsame, einheitliche Logik, fragten die im «Wiener Kreis» versammelten Wissenschaftler. Rudolf Carnap, einer der Hauptvertreter des sogenannten logischen Empirismus, verstand darunter eine Anzahl von Begriffen, logischen Sätzen, Arten der Beweisführung, Theorien usw., die nicht nur vermeintlich unvereinbaren philosophischen Systemen, sondern auch den empirisch arbeitenden Wissenschaften gemeinsam sein sollten. Das entscheidende Untersuchungsgebiet der Erkenntnistheorie war nach Carnap folglich die Sprache, genauer gesagt die Suche nach den «syntaktischen Beziehungen zwischen den verschiedenen Teilsprachen der Einen Wissenschaftssprache»5. Dabei wollte Carnap keineswegs bei einer Analyse stehen bleiben; ihm und seinen Mitstreitern ging es zugleich um die Grundlage einer neuen Wissenschaft, der «Einheitswissenschaft» eben – einer Wissenschaft, die sich nichts weniger als die Überwindung der bisherigen Spaltung der Wissenschaften zur Aufgabe gemacht hat. Alle Einzelthemen oder -gegenstände der bisher existierenden Disziplinen sollten in dieser Gesamtwissenschaft ihren Platz finden. Mehr noch arbeitete der Wiener Kreis an einer für alle Wissenschaften gültigen Universalsprache – Biologen und Physiker, Mathematiker und Soziologen sollten dieselbe Sprache sprechen. Fachsprachen sollten nicht gänzlich überflüssig werden, doch sollten sie sich immer auf die Universalsprache beziehen, welche nach Carnap eine aus der Physik entlehnte «physikalistische Sprache» sein sollte. Die Physik war ihm das Vorbild für alle anderen Wissenschaften.
Das klingt alles sehr abstrakt, doch blieb die Einheitswissenschaft keineswegs reine Theorie. Nicht zuletzt deshalb, weil die Mitglieder des Wiener Kreises einen sehr hohen politischen Anspruch hatten – Wissenschaft sollte ihren elitären Nimbus verlieren –, arbeiteten einzelne von ihnen an sehr praxisorientierten Projekten. Otto Neurath beispielsweise erarbeitete die «Wiener Methode der Bildstatistik»; seine Isotypen sind die Vorläufer all jener Piktogramme, die Du heute bei der Suche nach Toiletten, Fluchtwegen oder Strassen überall im Alltag vorfindest. Er verfolgte ein Enzyklopädieprojekt, das wie sein grosses französisches Vorbild ein Mosaik der Wissenschaften entwerfen sollte. Und schliesslich machte er sich auch Gedanken um die Popularisierung einheitswissenschaftlichen Gedankenguts. Einzelne Philosophen des Wiener Kreises waren sich nicht zu schade dafür, in Wiener Arbeiterbildungsvereinen tätig zu sein.
Was ich für unser Thema an dieser Geschichte der Einheitsidee faszinierend finde, ist, dass sie – ähnlich wie im Falle von de Solla Price – wissenschaftsbildend gewesen ist. Anders gesagt, die Suche nach der Einheit hat die Diversifizierung wissenschaftlicher Unternehmungen befördert. Zum einen betraf dies die erwähnten Versuche, in die gesellschaftliche Praxis hineinzuwirken. Wie kaum anders zu erwarten, haben die Einheitswissenschaftler auch ihre Gegner gehabt, die die Idee der Einheit kategorisch ablehnten. Theorien rufen Gegentheorien auf den Plan – das schafft Arbeit für Wissenschaftler. Jedenfalls wurden gegen die Idee der Einheit Lehren von der Vielheit der Wissenschaften entworfen und Wissenschaftstypen voneinander abgegrenzt, die wiederum historisch hergeleitet wurden. Sucht man nach Gründen für die Vielfalt, dann muss man sie vor allem in den Gegenstandsbereichen und ihrer Genese suchen, meinte etwa Kurt Lewin, ein Gegner der Einheitswissenschaft. Wie Individuen entwickeln sich wissenschaftliche Themenfelder aus ihren Vorläufern und geben ihre spezifischen Merkmale an die nächste Generation weiter. Im Grunde genommen sei es überraschend, dass es so wenige verschiedene Disziplinen gäbe. Eigentlich müsste es doch viel mehr geben. Tja, lieber Johannes, da sind wir wieder am Ausgangspunkt unseres Austausches angekommen. Haben wir eine abschliessende Antwort auf unsere Frage gefunden, wie wissenschaftliche Disziplinen entstehen? Ich fürchte: Nein. Ausser solchen allgemeinen Feststellungen, dass nämlich die Wissenschaft eine zutiefst soziale Angelegenheit ist und demzufolge alle Unwägbarkeiten des Sozialen beinhaltet, sind mir kaum konkrete Antworten begegnet. Aber das liegt wohl auch in der Art unserer Frage, die das Thema ziemlich unspezifisch und allgemein angeht. Gleichwohl bin ich keinesfalls unzufrieden. Was sichtbar geworden ist, ist die Standpunktabhängigkeit unserer Frage. Es ist zu grossen Teilen eine Frage der Perspektive, ob man eher viele oder eher wenige Disziplinen ausmacht, ob man Pluralität oder Einheit im Wissen schätzt. Aus den Arbeiten von Fleck und dem Wiener Kreis kann man lernen, dass manches oft genug mehr wissenschaftspolitische Programmatik als zwingende Sachlogik ist. Wissenschaft wird gestaltet, das zeigt die Geschichte. Und sie lässt erkennen, dass Fragen nach dem Charakter der wissenschaftlichen Unternehmung besonders dann Konjunktur hatten, wenn wissenschaftliche, politische, kulturelle Ereignisse in unvorhersehbarer Weise zusammentrafen. Allein, wieso stellen wir eigentlich die Frage nach der Geburt von Disziplinen?
Johannes Fehr: Weshalb oder inwiefern mir diese Frage wichtig scheint, glaube ich im Verlauf dieses Schriftwechsels doch besser verstanden zu haben. Das Verhältnis zum Neuen, denke ich, ist für die Wissenschaften tatsächlich eine Kernfrage. Wissenschaft ist definiert durch das Ziel, neue Erkenntnisse zu gewinnen. Was zählt, sind insofern nicht die Erkenntnisse, über die man bereits verfügt oder zu verfügen glaubt, sondern diejenigen, die man noch nicht hat. Und wenn sie offen für Neues bleiben sollen, kann es im Feld der Wissenschaften, zumindest dem Prinzip nach, nichts geben, was endgültig feststeht. Immer ist es möglich, dass der aktuelle Wissensstand revidiert werden muss und man sich von liebgewonnenen Gewissheiten zu verabschieden hat. Ebenso klar ist aber auch, dass neue Erkenntnisse kaum vorhersehbar sind, dass man weder weiss, wie – auf welchen Wegen und Umwegen – man auf sie stösst, noch worin sie bestehen. Zu sagen, dass man nach neuen Erkenntnissen sucht, ist sicher eine empfehlenswerte Strategie, wenn es darum geht, Forschungsgelder zu akquirieren. Ob aus einer Arbeit indessen neue Erkenntnisse folgen und, vor allem, ob diese aufgegriffen werden, ob sie anhaltende Resonanz finden und sich dadurch als relevant erweisen, steht auf einem ganz andern Blatt. Denn was sich als wirklich neu und wegweisend herausstellt, lässt sich erfahrungsgemäss erst im Nachhinein sagen. Neue Erkenntnisse und daraus eventuell entstehende Disziplinen sind das eine, Innovationsrhetorik und planerischer Aktivismus das andere. Angesichts des allenthalben spürbaren Ökonomisierungsdrucks scheint es mir wirklich hilfreich, diese Unterscheidung nicht aus dem Blick zu verlieren.
2 Sylvain Auroux, Introduction. Émergence et domination de la grammaire comparée, in: ders., Histoire des idées linguistiques, Band 3, Bruxelles: Mardaga 2000, S. 3.
3 Lorraine Daston, Science Studies and the History of Science, in: Critical Inquiry 35 (2009), S. 798–813.
4 Ludwik Fleck, Erfahrung und Tatsache. Gesammelte Aufsätze, hrsg. von Lothar Schäfer und Thomas Schnelle, Frankfurt a. M.: Suhrkamp 1983, S. 78.
5 Rudolf Carnap, Die Aufgabe der Wissenschaftslogik, Wien: Gerold & Co. 1934, zitiert nach: Kristian Köchy, Vielfalt der Wissenschaften bei Carnap, Lewin und Fleck. Zur Entwicklung eines pluralen Wissenschaftskonzepts, in: Berichte zur Wissenschaftsgeschichte 33/1 (2010), S. 57.